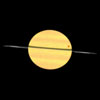|
|
 |
SeaLaunch
Raketenstart im Pazifik |
 |
|
| Während eines Startversuchs am 30. Januar 2007 explodierte eine SeaLaunch Zenit 3SL Rakete auf der schwimmenden Odyssey-Startplattform im pazifischen Ozean. Die Rakete sollte den Telekommunikations-Satelliten NSS 8 in den Orbit befördern. |
 |
 |
| SeaLaunch |
| Animation der Katastrophe |
Das per WebCast von SeaLaunch veröffentlichte Video zeigt die russische Rakete, die zum Startzeitpunkt leicht herabsinkt und kurz danach in einer gewaltigen Explosion zerstört wird. Menschen kamen bei dem Unglück nicht zu schaden, da sich das Startteam zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Kommandoschiff Sea Launch Commander in einer Entfernung von etwa 5 Kilometern befand. Der Zustand der Odyssey Plattform - einer umgebauten norwegischen Ölbohrplattform, sowie die Ursache der Fehlfunktion ist bislang noch ungeklärt.
Der Start am 30. Januar 2007 sollte der 24. in der Geschichte des jungen Unternehmens SeaLaunch seit ihrer Aufnahme des Programms im Jahr 1999 sein. Es ist der zweite gescheiterte Start von SeaLunch, nachdem bereits am 12. März 2000 während des dritten Starts die zweite Stufe einer Rakete nicht richtig zündete. Die Zenit 3SL konnte damals ihren geplanten Orbit nicht erreichen und stürzte in den Ozean. Im Juni 2004 schaltete die obere Stufe einer solchen Rakete zu früh ab, so dass der beförderte Satellit Telstar 18 in einem niedrigeren Orbit ausgesetzt werden musste. |
 |
 |
| SeaLaunch |
| Früherer gelungener Start im Pazifik |
Im Jahr 2007 sollten insgesamt sechs Raketen von der Plattform Odyssey abheben. SeaLunch wurde 1995 gemeinsam von dem US-amerikanischen Unternehmen Boeing, der russischen RKK Energia, den ukrainischen Raketen-Herstellern KB Juschnoje und PO Juschmasch, sowie dem norwegischen Schiffbauer Aker Kvaerner gegründet.
Sea Launch startet von Odyssey aus seit 1999 Zenit-Trägerraketen in Äquatornähe von einer Position 2.200 Kilometer südlich von Hawaii und befördert so Satelliten mit einer Masse von bis zu 6 Tonnen in eine Erdumlaufbahn. Der Vorteil einer Startbasis in Äquatornähe liegt darin, dass dort die Rotationsgeschwindigkeit der Erde schon einen großen Teil der für einen Orbit nötigen Geschwindigkeit bereitstellt, so dass die Rakete mehr Nutzlast bei gleicher Leistung befördern kann. |
|
 |
 |
Titan-Transite |
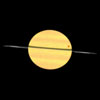 |
| 2025 kann der Saturnmond Titan vor dem Globus des Ringplaneten beobachtet werden |
|
       |